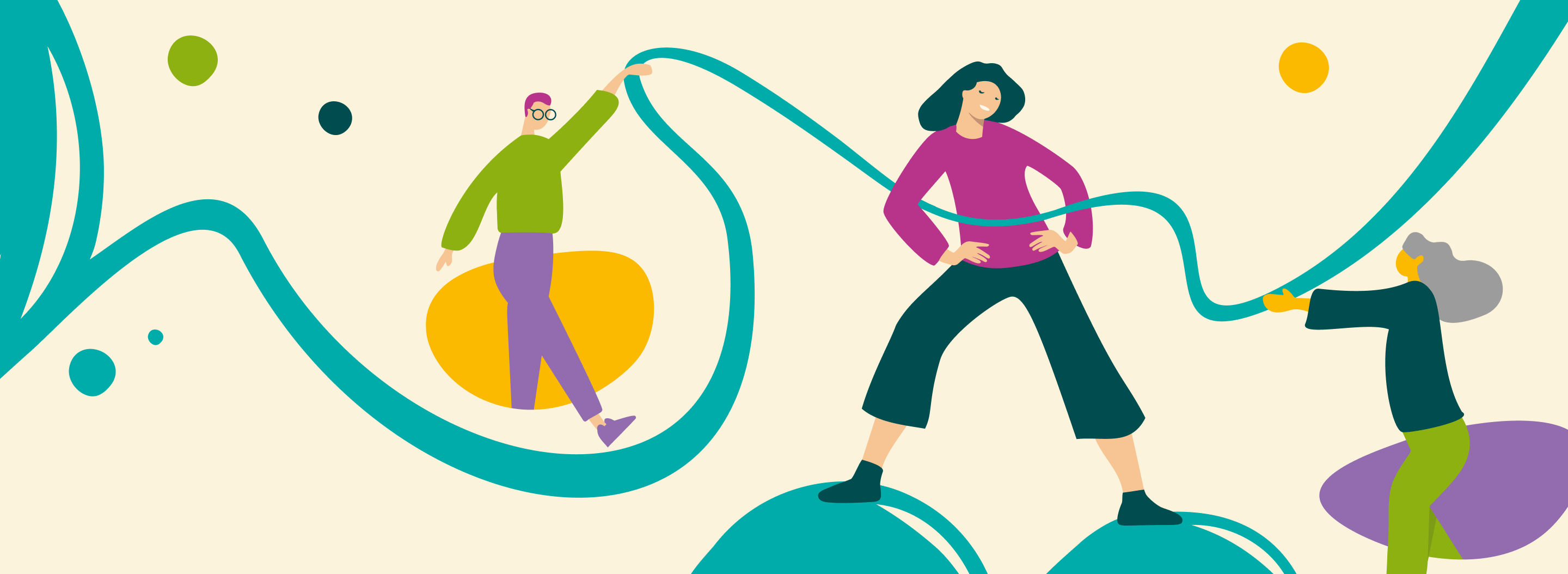 © sowhat
© sowhatHäufige Fragen zu Essstörungen
Antworten auf Ihre Fragen
Essstörungen haben in der Regel nicht eine einzige Ursache, sondern entstehen aus einem Zusammenspiel verschiedener Faktoren. Häufig sind psychische, soziale, familiäre und biologische Einflüsse beteiligt.
Persönlichkeitsmerkmale
Viele Betroffene stellen besonders hohe Ansprüche an sich selbst. Perfektionismus, ein starkes Bedürfnis nach Harmonie und die Tendenz, Kritik sehr persönlich zu nehmen, sind häufig. Außerdem sind ein geringes Selbstwertgefühl und ein schwaches Körpergefühl typisch. Solche Eigenschaften können die Entstehung einer Essstörung begünstigen.
Soziale Faktoren und Schönheitsideale
Gesellschaftliche Schönheitsnormen sind ein wichtiger Risikofaktor – sie allein erklären Essstörungen aber nicht. Medien und soziale Netzwerke vermitteln oft unrealistische Körperbilder, die besonders Jugendliche verunsichern. Wenn Attraktivität als Voraussetzung für Anerkennung erlebt wird, versuchen junge Menschen, ihr Selbstwertgefühl über Körperkontrolle zu stabilisieren. Diäten, die so beginnen, können eine Eigendynamik entwickeln und in eine Essstörung münden. Alarmierend ist, dass schon Kinder unter 10 Jahren ein bedrückendes Gefühl zwischen „Ist“ und „Soll“ erleben und früh mit Diäten beginnen.
Familiäre Einflussfaktoren
Essstörungen entstehen häufiger in Familien, die nach außen sehr harmonisch wirken, in denen jedoch Konflikte oft verdrängt werden. Betroffene übernehmen nicht selten schon früh Verantwortung, während Stärke, Leistung und Selbstbeherrschung überbetont werden.
Weitere Risikofaktoren sind traumatische Erfahrungen, mangelnde Abgrenzung, ein überfürsorglicher Erziehungsstil, familiäre Disharmonie oder Gewalterfahrungen. Entscheidend ist auch die Qualität der Eltern-Kind-Bindung, die die emotionale Entwicklung stark prägt.
Menschen mit Essstörungen sind häufiger unsicher-ambivalent gebunden. Sie richten ihre Aufmerksamkeit stark auf andere, um deren Erwartungen zu erfüllen, und verlieren dabei zunehmend den Zugang zu den eigenen Emotionen. Mit der Zeit übernimmt dadurch ein „falsches Selbst“ die Kontrolle.
Sexueller Missbrauch
Sexueller Missbrauch kann in manchen Biografien eine Rolle spielen, ist aber keine automatische Ursache für eine Essstörung. Es gibt viele Betroffene ohne solche Erfahrungen und umgekehrt Menschen mit Missbrauchserfahrung, die keine Essstörung entwickeln. Pauschale Schlussfolgerungen sind daher nicht angebracht; jede Lebensgeschichte ist individuell.
Biologische Einflussfaktoren
Forschungen im Bereich der Molekulargenetik zeigen, dass auch erblich bedingte Faktoren zur Entwicklung einer Magersucht beitragen können. Familien- und Zwillingsstudien belegen, dass enge Verwandte von Betroffenen ein deutlich erhöhtes Risiko haben, ebenfalls zu erkranken. Je näher der Verwandtschaftsgrad, desto größer ist dieses Risiko. Man geht davon aus, dass mehrere Gene in Kombination eine solche Anfälligkeit begünstigen können.
Neben genetischen Einflüssen spielen auch biologische Faktoren eine Rolle bei der Entstehung und Aufrechterhaltung der Erkrankung. Besonders auffällig sind Veränderungen im Neurotransmittersystem. Verschiedene Botenstoffe beeinflussen das Esszentrum im Gehirn – darunter Dopamin und Serotonin. Beide wirken nicht nur auf Stimmung und Gefühle, sondern steuern auch den Hunger-Sättigungs-Mechanismus. Bei vielen Menschen mit Essstörungen findet man erniedrigte Spiegel dieser Neurotransmitter.
Diäten
Oft geht einer Essstörung eine Diät voraus. Sobald das Gedankenkarussell — also das ständige Grübeln über Essen oder Nicht-Essen — die Kontrolle übernimmt, besteht erhöhte Gefahr, dass aus einer Diät eine ernsthafte Essstörung entsteht. Achten Sie auf frühe Warnsignale.
Die folgenden Verhaltensweisen und Veränderungen können auf eine beginnende Essstörung hinweisen. Ein oder zwei Punkte allein müssen nicht bedeuten, dass eine Essstörung vorliegt — mehrere Hinweise zusammen oder eine anhaltende Veränderung sollten jedoch ernstgenommen werden.
Essverhalten und Kontrolldenken
Häufiges Wiegen und akribisches Kalorienzählen.
Ständiges Gefühl, zu dick zu sein, und wiederholte Ablehnung des eigenen Körpers.
Dauerndes Kritisieren einzelner Körperpartien (z. B. „zu dicker Bauch“, „zu breite Hüften“).
Körper wird durch überweite Kleidung kaschiert
Häufiges Essen großer Mengen (Essanfälle) oder vermehrter Heißhunger auf Süßes.
Verstecken oder Horten von Lebensmitteln, leere Verpackungen im Zimmer, Verschwinden großer Nahrungsmengen aus der Küche.
Essen als Reaktion auf Frust, Stress oder Ärger; Schwierigkeiten, Gefühle oder Bedürfnisse auszudrücken.
Verhaltensweisen zur Gewichtskontrolle
Kauf/Verwendung von Abführmitteln, Appetitzüglern, entwässernden Mitteln oder anderen Präparaten zum Abnehmen.
Übermäßiger Sport, oft unabhängig von Tageszeit oder Wetter, ausschließlich zum Zwecke der Gewichtsreduktion.
Häufiges Aufsuchen der Toilette nach dem Essen, Spül- oder Duschgeräusche zum Überdecken von Brechgeräuschen.
Körperliche und medizinische Zeichen
Ausbleiben von mindestens drei Menstruationszyklen im fortgeschrittenen Stadium
Geschwollene Speicheldrüsen, Verletzungen an den Mundwinkeln oder Fingern, Veränderungen am Zahnschmelz (durch die Magensäure bei wiederholtem Erbrechen).
Starke Gewichtsschwankungen oder andere deutliche körperliche Veränderungen.
Im Extremfall: Herzrhythmusstörungen oder Nierenschäden aufgrund von Kalium- und Natriummangel durch entwässernde Medikamente.
Psychische und emotionale Warnsignale
Starke Leistungsorientierung, perfektionistisches Verhalten und übertrieben hohe Erwartungen an sich selbst.
Niedriges Selbstwertgefühl, Selbstabwertung bis hin zu Selbsthass.
Große Verlust- oder Trennungsängste.
Depressionen oder Angststörungen durch mangelndes Selbstvertrauen und ständige Selbstzweifel
Schwarz-weiß-Denken (extremes, rigides Denken).
Sozialer und funktionaler Rückzug
Soziale Isolation, Rückzug aus Freundes- oder Familienkontakten.
Schwierigkeiten im Alltag (Schule, Ausbildung, Arbeit) durch übermäßiges Kontrollverhalten oder Leistungsdruck.
Weitere Auffälligkeiten und Risikoverhalten
Übermäßiges Waschen, ritualisierte Kontrollzwänge oder andere Zwangshandlungen.
Impulsives, aggressives Verhalten oder heftige Wutausbrüche.
Selbstverletzendes Verhalten (z. B. Ritzen, Kratzen) sowie exzessives Nägelkauen.
Missbrauch von Alkohol, Medikamenten oder anderen Drogen.
Gelegentliches Stehlen von Lebensmitteln (Ladendiebstahl).
1. Interesse an der Person zeigen
Fragen Sie nach dem allgemeinen Befinden – nicht nach Essen, Gewicht oder Figur. Die betroffene Person möchte als ganzer Mensch wahrgenommen werden, nicht nur über die Essstörung definiert werden.
2. Sich informieren
Lesen Sie über Essstörungen und deren Erscheinungsformen. Verlässliche Informationen finden Sie z. B. auf unserer Homepage.
3. Verständnis haben
Die betroffene Person kann nicht einfach „normal“ essen. Druck oder Zwang helfen nicht.
4. Direkt das Gespräch suchen
Reden Sie lieber mit der Person selbst, statt über sie mit anderen.
5. Beobachtungen sachlich ansprechen
Beschreiben Sie ruhig und klar, was Sie wahrnehmen und weshalb Sie sich Sorgen machen. Bleiben Sie dabei bei konkreten Beobachtungen.
6. In der Ich-Form sprechen
Formulieren Sie Ihre Eindrücke so: „Ich habe den Eindruck, dass es dir nicht gut geht …“. Das wirkt weniger bedrohlich und erleichtert ein offenes Gespräch.
7. Respektvoll bleiben
Begegnen Sie der Person wie jedem anderen auch – nicht übervorsichtig, sondern auf Augenhöhe.
8. Hilfe anbieten und Mut machen
Oft fällt es Betroffenen schwer einzusehen, dass sie Hilfe brauchen. Machen Sie deutlich: Unterstützung anzunehmen oder eine Therapie zu beginnen, ist ein Zeichen von Stärke, nicht von Schwäche.
9. Eigene Unterstützung suchen
Vergessen Sie nicht auf sich selbst. Auch Angehörige und Freunde dürfen Hilfe in Anspruch nehmen, um diese Situation besser zu bewältigen.
Der Body-Mass-Index (BMI) ist eine Maßzahl für das Körpergewicht eines Menschen im Verhältnis zu seiner Größe.
Der BMI lässt sich folgendermaßen berechnen: Gewicht in Kilogramm dividiert durch Körpergröße in Metern zum Quadrat.
Bei der Interpretation des BMI spielt das Alter eine wesentliche Rolle. Bei Kindern und Jugendlichen muss vor allem der klinische Allgemeinzustand beachtet werden.
Bei Erwachsenen besteht bei einem BMI von 17,5 oder darunter der Verdacht auf Magersucht. Dieses Maß gibt allerdings nur einen groben Richtwert an. Die Statur eines Menschen und die individuell unterschiedliche Zusammensetzung des Körpergewichts aus Fett- und Muskelgewebe kann im BMI nicht berücksichtigt werden.
Hier können Sie Ihren BMI ausrechnen.
Weitere Fragen?
Sie haben eine konkrete Anfrage oder ein besonderes Anliegen? Schreiben Sie uns, unser Team hilft Ihnen gerne weiter.

